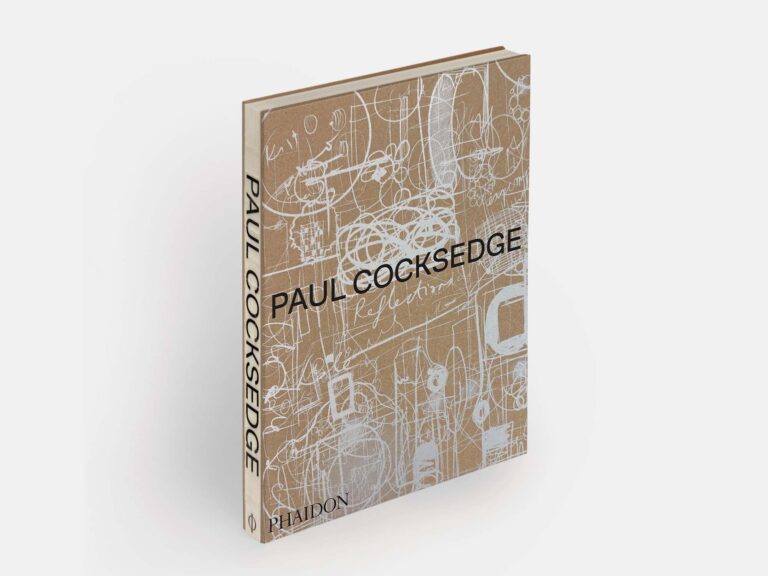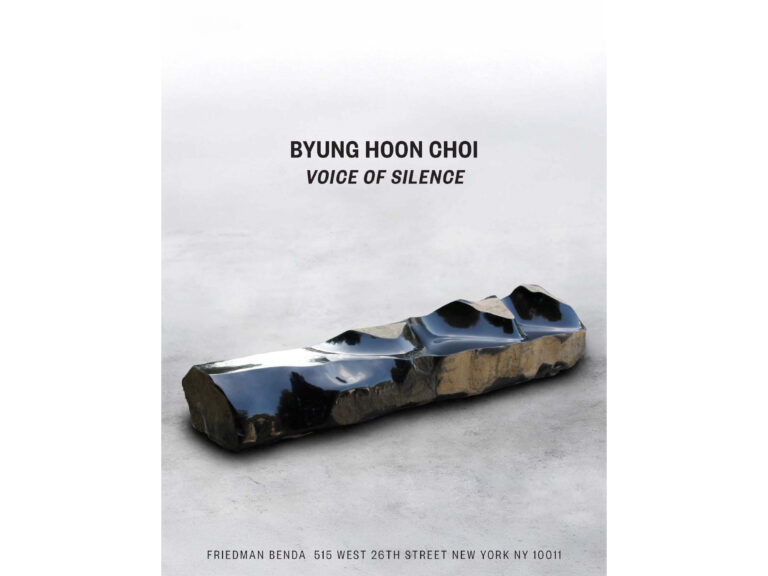By Susanna Koeberle
Ihre ersten Leuchten entwickelte d ie schweizerisch-italienischen Designerin Carmen D’Apollonio, weil sie alle im Angebot so langweilig fand. Heute ist sie für ihre Keramik-Einzelstücke international bekannt
Ihre Leucht-Skulpturen wirken irgendwie erschöpft. Träge schmiegen sie sich an eine Fläche und ragen “kopfvoran” über diese nach unten, als fehlte ihnen die Kraft, sich aufzurichten. Zugleich strahlen die Kreationen von Carmen D’Apollonio durchaus etwas Lebensfrohes und Vitales aus. Hängt dieser Widerspruch damit zusammen, dass die Stücke fast etwas Beseeltes und Wesenhaftes haben? Lebendes ändert eben seine Stimmung. Häufig kann man nicht einmal festmachen, ob es sich bei den Objekten um Darstellungen von Menschen, Tieren, Pflanzen oder um abstrakte Formen handelt. Aber das ist auch nicht weiter wichtig. Fest steht, dass man die Arbeiten der schweizerisch-italienischen Keramikerin nicht so schnell vergisst. Und dass sie mit ihren Leuchten und Gefässen aus Keramik oder Bronze mittlerweile international eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Die Einzelstücke haben den Sprung vom reinen Gebrauchsobjekt zum “objet d’art” geschafft – wobei D’Apollonio selber diesbezüglich nicht so streng unterscheiden möchte, für sie bleiben ihre Entwürfe Leuchten oder zumindest nützliche Skulpturen. Seit 2019 wird sie durch die renommierte Design-Galerie Friedman Benda aus New York vertreten, im Januar 2023 wird sie in der Zweigstelle der Galerie in Los Angeles ihre zweite grosse Einzelausstellung ausrichten.
In Los Angeles wohnt und arbeitet Carmen D’Apollonio seit 2014, nachdem sie zuvor längere Zeit in New York gelebt hat. Schon als Assistentin des Schweizer Künstlers Urs Fischer, für den sie zwischen 2003 und 2012 tätig war, wollte sie Töpferkurse besuchen, doch es kam erst viel später in Zürich dazu, wie sie im Interview erzählt. In ihrem Atelier, das sie mit einer Malerin teilt, wimmelt es von riesigen Stücken, die mit Plastikfolien abgedeckt sind und der Trocknung harren – dieser Vorgang kann je nach Grösse bis zu sechs Monate dauern! Andere bereits getrocknete und vorgebrannte Objekte warten darauf, glasiert zu werden, bevor sie ein zweites Mal gebrannt werden, diesmal mit höheren Temperaturen. All das ist eine komplizierte und stufenweise Prozedur, die einer grossen Expertise bedarf. Ganz genau weiss D’Apollonio allerdings nie, was sie nach dem Brand erwartet, trotz der langjährigen Erfahrung, die sie inzwischen hat. Keramik zu machen, gleicht einer alchemistischen Verwandlung, die Kontrolle und Unberechenbarkeit vereint. Diese Spannung gehört zu jedem künstlerischen Prozess.


Kreativ war die 1973 in Zürich Geborene schon, bevor sie zur Keramik als Ausdrucksmittel fand. Nach einer Ausbildung zur Dekorationsgestalterin war sie in verschiedenen Berufen tätig und heuerte schliesslich bei Urs Fischer an, bei dem sie auch viel über die Herstellung von Skulpturen lernte. 2006 gründete sie mit einer Freundin den Brand Ikou Tschüss, den es bis heute gibt. Für Schweizer Verhältnisse waren die Entwürfe der beiden “Secondas” ziemlich gewagt und kaum einzuordnen. Die Experimentierfreudigkeit ist ihr geblieben. Das merkt man schon daran, dass ihre Leuchten mit wachsendem Know-how immer grösser wurden. Seit drei Jahren besitzt sie einen eigenen grossen Ofen, in dem sie auch mannshohe Stücke brennen kann. Für solche Teile braucht sie bis zu 250 Kilogramm Ton, eine Zahl, bei der einem fast schwindlig wird, wenn man nur schon an die Handhabung der Masse denkt. Es erstaunt auch nicht, dass diese Riesen der Hitze nicht immer standhalten können; gerade kürzlich seien zwei Objekte beim Brennen kaputtgegangen, sagt sie. Sie lässt sich von solchen Rückschlägen nicht beirren. Kleinere Teile fügt sie nach dem Brennen zusammen und schafft daraus landschaftsähnliche Skulpturen. Doch auch diese grösseren Artefakte versieht D’Apollonio mit Lampenschirmen und reizt damit weiter die Grenze zwischen Gebrauchsobjekt und Kunstwerk aus.
Zu den Leuchten sei sie eigentlich eher zufällig gekommen. Sie habe sie zuerst für sich selber gemacht, weil sie die gängigen Modelle einfach langweilig gefunden habe, sagt sie. Ihre ersten Lichtobjekte sahen noch relativ klassisch aus, die Keramik war ja noch Neuland für sie. Nach und nach probierte sie Neues aus und wurde mutiger, was Formensprache und Farbigkeit betrifft. Der Vergleich mit der Welt der Pflanzen ist nicht so weit hergeholt, denn ihre Arbeit ist organisch weitergewachsen, manchmal spriessen sogar sonderbare Pilze wie Wesen von einem fremden Planeten auf ihren Skulpturen. Der Pilz als Motiv hat in der Geschichte des Leuchten-Designs Tradition, wohl aufgrund der Analogie von Lampenfuss und Lampenschirm mit der Gestalt von Pilzen. D’Apollonios Umgang damit ist weit verspielter und bricht mit Konventionen. “Pilze sehen einfach gut aus”, antwortet sie, als man sie nach dem Grund für dieses Sujet fragt, und erzählt dann gleich, wie sie diese fertigt. Man spürt dabei ihre Freude am Material Ton und an seiner Verarbeitung mit den Händen. Bei filigranen Formen ist das Modellieren direkter als bei den massiver gestalteten Leuchten, wo die Keramikerin die Tonmasse langsam aufbauen und genau darauf achten muss, dass die Wanddicke überall gleicht bleibt. Der Transport der grossen Arbeiten vom Arbeitsplatz zum Ofen ist eine Zitterpartie, denn jede Erschütterung kann zu Rissen führen. Mittlerweile hat sie einen Assistenten, der ihr im Atelier hilft, allein könnte sie das nicht alles stemmen, gerade wenn es darum geht, eine grössere Ausstellung vorzubereiten. Seit ihrer Zusammenarbeit mit Friedman Benda ist Bronze als Material hinzugekommen. Diese Editionen vereinfachen den Entstehungsprozess ein wenig, da sie die Stücke nur einmal brennen muss.
Gewisse Formen wie der «Wurm» – wie sie diese salopp nennt – kommen seit den Anfängen immer wieder vor, andere Motive entwickelten sich erst mit der Zeit. Ihre Ideen hält D’Apollonio in Notizbüchern fest und greift später, wenn es ans Modellieren geht, darauf zurück. Gemeinsamer Nenner ihres gestalterischen Vokabulars ist das Fliessende, Runde und Gebogene. Man wird beim Betrachten ihrer Arbeiten unweigerlich an Werke der klassischen Moderne erinnert – im Gespräch fallen denn auch die Namen von Henry Moore, Pablo Picasso, Alberto Giacometti oder Constantin Brâncuşi. Assoziationen ergeben sich auch zum disziplinenübergreifenden Werk von Isamu Noguchi. Solche Vergleiche scheut die Kunsthandwerkerin zwar nicht, doch sie bleibt zugleich bescheiden, wenn man sie auf die Problematik der Konkurrenz zwischen angewandter und freier Kunst anspricht. Sie möchte, dass man ihre Stücke auch als Vasen oder Schalen nutzen kann; nur so aussehen sollen sie nicht. Allerdings ist es auch so, dass sie manchmal zu den Leuchten auch ein eigens hergestelltes Podest mitliefert, sonst könnte man die abenteuerlich gebogenen Teile nirgends aufstellen.
Ebenso ungewöhnlich sind auch die Titel, die D’Apollonio ihren Objekten gibt. Hier zeigt sich auch ihr Sinn für Humor: «Das Wichtigste ist für mich, dass Leute lachen können, wenn sie den Titel lesen», sagt sie. Inspirationen dafür findet sie zum Beispiel in Songtiteln, die sie dann etwas adaptiert. Die Namen ihrer Objekte sollten nicht zu seriös daherkommen, findet sie. Das würde auch ihrem Naturell widersprechen. Carmen D’Apollonios Leuchten sind nicht nur ungewöhnlich schön, sie sind wie gute Freunde: Sie sind immer da, erhellen die Dunkelheit und bringen einen zum Lachen.